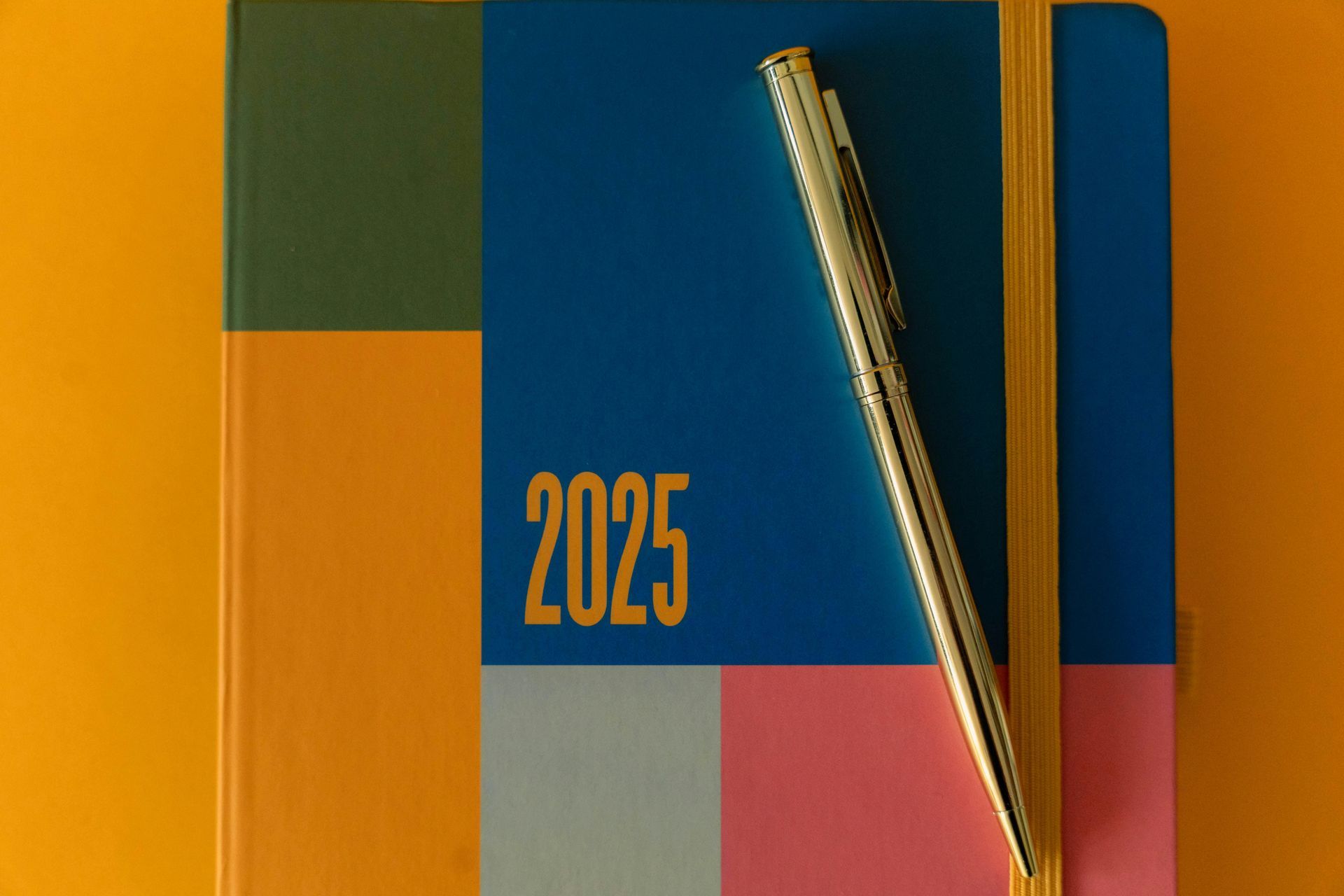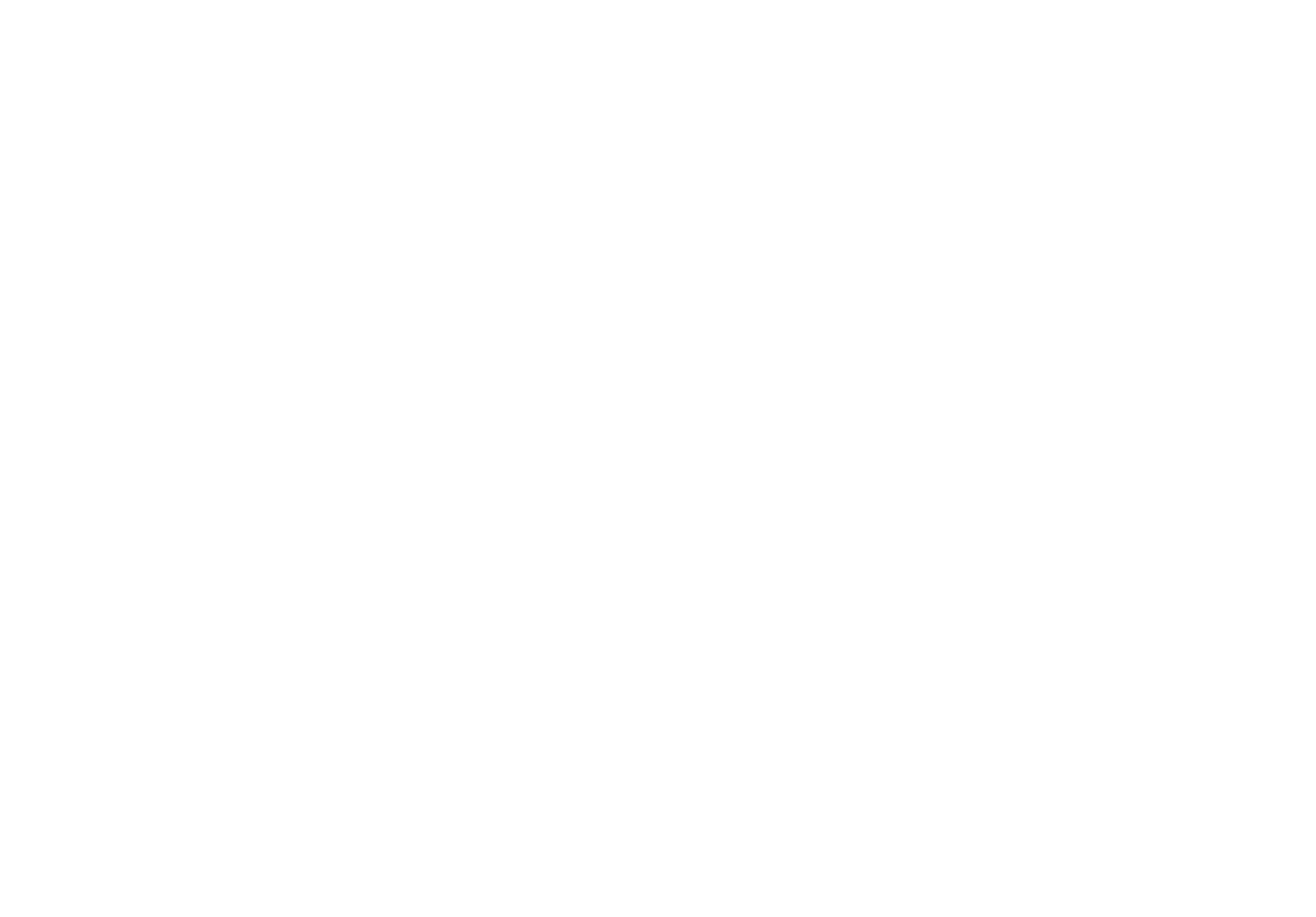Kinästhetik - Das steckt hinter dem Konzept
Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung sind häufig in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Das stellt für die Betroffenen selbst aber auch für Pflege- und Betreuungskräfte eine physische Herausforderung dar. Das Konzept der Kinästhetik kann Abhilfe schaffen und für Entlastung auf beiden Seiten sorgen. Denn Bewegungen werden hierbei so eingesetzt, dass der Kraftaufwand für minimiert wird. Gleich ob Sie Pflegekraft oder pflegender Angehöriger sind: Wir erklären Ihnen, wie Kinästhetik funktioniert.
Was ist das Ziel der Kinästhetik?
Kinästhetik bedeutet so viel wie Bewegungsempfindung. Sind wir gesund und unversehrt, kontrollieren und steuern wir unsere Bewegungen meist ganz unbewusst. Mit Hilfe der Kinästhetik sollen Bewegungen nun bewusst wahrgenommen werden. Immobile Menschen sollen dazu ihre Körperbewegungen gezielt unterstützen und erfahren. Ziel ist es, die Bewegungsfreiheit zu verbessern und so die eigene Mobilität möglichst zu erhalten. Auch dient die Kinästhetik der Prophylaxe, da durch die Mobilisation das Risiko für Druckgeschwüre, Thrombosen und Lungenentzündungen gesenkt werden kann. Nicht zuletzt kann Kinästhetik auch das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl der Betroffenen steigern. Denn die zunehmende Eigenständigkeit und Kontrolle über den eigenen Körper wirken sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern auch auf den Gemütszustand positiv aus.
Auch für Pflegende ergeben sich Vorteile. Da die bzw. der Betroffene mehr Eigenaktivität erlangt und viele Bewegungsmöglichkeiten ausschöpfen kann, verringert sich die körperliche Anstrengung für Pflegende. Ebenso können durch die Zusammenarbeit die Kommunikation verbessert und die Vertrauensbasis intensiviert werden.
So funktioniert es: Die sechs Konzepte der Kinästhetik in der Pflege
In der praktischen Anwendung wird Kinästhetik ausgeführt, indem die hilfsbedürftige Person in Bewegungsmuster eingebunden wird. Denn nur durch aktive Mitarbeit können die eigene Bewegungsfreiheit und Körperkontrolle so unterstützt werden, dass in der Folge die Selbstständigkeit gefördert und gleichzeitig Abhängigkeit sowie Hilflosigkeit gemindert werden. Was bei der Kinästhetik zu beachten ist, lässt sich in sechs Grundprinzipien erklären:
- Interaktion: Alle Bewegungen werden gemeinsam und schrittweise ausgeführt. Die Kommunikation findet hauptsächlich über Berührungen statt. Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihre Hilfe an den individuellen Unterstützungsbedarf anpassen und nur so viel assistieren, wie auch wirklich nötig ist. Hier sind fachliches Wissen und menschliches Gespür gleichermaßen gefragt.
- Funktionale Anatomie: Es ist von Vorteil, wenn Sie sich mit der Verteilung von Kraft im Körper auskennen. Kinästhetik unterscheidet zwischen Massen (Kopf, Arme, Brustkorb, Becken, Beine) und Zwischenräumen (Hals, Achselhöhlen, Taille, Hüftgelenke). Um die körpereigenen Ressourcen optimal zu nutzen, gilt der Grundsatz: “Massen fassen, Zwischenräume lassen.” Denn werden Zwischenräume berührt, besteht die Gefahr, dass immobile Menschen verkrampfen und Bewegungsmöglichkeiten blockiert werden.
- Menschliche Bewegung: Kinästhetik unterscheidet zwischen den drei Bewegungsmustern Beugen, Strecken und Drehen. Zusammen ergeben sie sog. spiralige Bewegungen, welche die Mobilisation erleichtern. Zur menschlichen Bewegung gehört auch, dass zu pflegende Personen unterstützende Bewegungen lernen können, um Sie als Pflegende bei alltäglichen Handlungen wie etwa der Lagerung zu entlasten.
- Anstrengung: Körperliche Anstrengung kann und sollte gezielt dosiert werden. Kraftintensive Maßnahmen wie schweres Heben und Tragen sind daher zu vermeiden. Stattdessen kommen alternative Techniken wie Ziehen und Drücken an den Körpermassen zum Einsatz. Diese können zur aktiven Bewegung animieren.
- Menschliche Funktion: Die Kinästhetik kennt sieben verschiedene Grundpositionen (z. B. Stehen, Sitzen, Rückenlage). Sie sollten für die Bewegungsgestaltung stets beachten, welche der Positionen die immobile Person durch Gewichtsverlagerung selbst einnehmen und halten kann.
- Umgebungsgestaltung: Die Umgebung sollte so gestaltet sein, dass sie die kinästhetische Mobilisation unterstützt. Etwa können manche Möbel oder Pflegeutensilien zu nützlichen Hilfsmitteln werden.
Angewandte Kinästhetik: Ein Praxisbeispiel
Vielen Menschen mit Bewegungseinschränkung fällt das eigenständige Aufstehen von einem Stuhl schwer. Möchte man helfen, sollte man keinesfalls unter die Achseln greifen und ruckartig ziehen. Das erfordert nicht nur zu viel Kraft, sondern kann auch zu Schmerzen oder gar Verletzungen führen. Besser ist es, Kopf und Oberkörper langsam in Richtung Boden zu bewegen, wodurch sich das Gewicht verlagert. So kann das Becken leichter vom Stuhl angehoben werden.
Fazit: Weniger Kraftaufwand - mehr Bewegung
In der Kinästhetik nehmen Personen mit Unterstützungsbedarf aktiv am Pflegeprozess teil. Folgen die gemeinsam durchgeführten Übungen immer gleichen Mustern, können Bewegungsabläufe neu erlernt oder erhalten werden und die Betroffenen dadurch zumindest teilweise ihre Unabhängigkeit wiedererlangen. Für Pflegende bedeutet die gesteigerte Bewegungsfähigkeit ebenfalls eine große körperliche Entlastung. Kinästhetik kann dabei nicht nur von professionellen Pflegekräften durchgeführt werden, sondern eignet sich nach einer entsprechenden Schulung auch für die häusliche Pflege durch Angehörige. Sprechen Sie uns bei Fragen zum Thema gerne an!